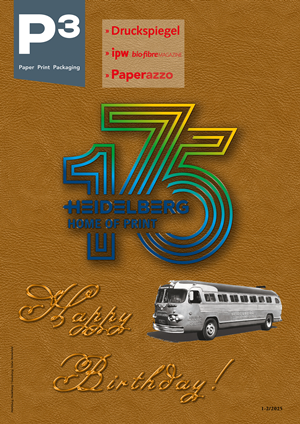P3 5-6/2022 de
Weinmarketing
„Die Energieverschwendung im deutschen Weinbau ist kompletter Irrsinn.“
Trends & Practice

Orpheus & The Raven: Ausgezeichnet mit dem The Drinks Business Award 2020 in der Kategorie „Best Design & Packaging“.
„Rotwein ist für alte Knaben / eine von den besten Gaben“, pflegte mein Großvater seligen Angedenkens zu sagen. So weit, so gut. Aber: Warum kaufe ich eine bestimmte Flasche? Wie nachhaltig - oder energieintensiv - sind die Herstellung einer attraktiven, evtl. preisgekrönten Verpackung und Flasche wirklich? Und: Wie nachhaltig ist der Anbau? Ist das Weingut transparent hinsichtlich seines CO2-Fußabdrucks? In welchem Zustand ist der Boden? Ist das Gesamtkonzept überhaupt wettbewerbs- und zukunftsfähig? Und wieviel Blendwerk kaufe ich?
Wer an der Hochschule Heilbronn im Studiengang Weinmarketing & Management tätig ist, beschäftigt sich längst nicht nur mit leckeren Tropfen und metallfolieveredelten Verpackungen. Sie und er brauchen Antworten auf die gestellten Fragen und umfassende Kenntnisse sowohl im Marketing als auch im Weinbau. P3 sprach mit Friederike Watzl und Prof. Dr. Daniel Deimling, beide etablierte Wissenschaftler in eben jenem Studiengang.
Orpheus & The Raven: Ausgezeichnet mit dem The Drinks Business Award 2020 in der Kategorie „Best Design & Packaging“.
Frau Watzl, vielleicht möchten Sie damit beginnen, uns etwas über die Arbeit und die Herausforderungen im Fachbereich „Weinmarketing & Management“ zu erzählen?
F.W.: Gerne! Der Studiengang Weinmarketing & Management an der Hochschule Heilbronn ist ein Bachelorstudium (Bachelor of Arts) in Vollzeit, das am Bildungcampus in Heilbronn innerhalb von 7 Semestern abgelegt werden kann (https://www.hs-heilbronn.de/de/wmm). Den Studiengang Weinmarketing und Management gibt es nun seit bereits 35 Jahren in Heilbronn (früher hieß dieser Weinbetriebswirtschaft und zwischenzeitlich Internationales Weinmarketing). Das Studium Weinmarketing und Management bildet die optimale Basis für alle Absolventen, um später die spannende Weinbranche mitgestalten zu können. Für eine Weinwirtschaft, die auch in der Zukunft konkurrenzfähig sein will, sind Führungskräfte sowie gut ausgebildete Manager und Managerinnen, die in der Lage sind, sich den komplexen Problemen des Weinmarktes zu stellen, unerlässlich. Steigender Wettbewerb, weltweit vernetzte Märkte und verstärkter Preiswettbewerb erfordern neben fundierten betriebswirtschaftlichen Kenntnissen auch ein breites Weinwissen.
Neben der tollen und spaßbringenden Arbeit mit den Studierenden ist die Bildungsbranche jedoch im allgemeinen mittlerweile auch ein stark umkämpfter Markt. Es geht immer um Bewerberzahlen. Gefühlt wächst das Bildungsangebot um uns herum täglich - die Anzahl der Bewerber und Bewerberinnen verteilt sich also auf eine deutlich größere Menge an Einrichtungen. Es ist wichtiger als je zuvor, auch für den Studiengang, in dem Marketing studiert wird, Marketing zu betreiben.
Die Verpackungen alkoholhaltiger Getränke im Allgemeinen und Weinverpackungen im Besonderen scheinen heutzutage mehr denn je eine Spielwiese für alle möglichen Designvarianten und Veredelungstechniken zu sein, die man sich vorstellen kann. Lassen sich mit einem aufwändigen und auffälligen Verpackungsdesign inhaltliche Mängel kaschieren? Oder anders gefragt: Beurteilen heutige Käufer eher die Verpackung, oder hinterlässt der Flascheninhalt den nachhaltigeren Eindruck?
„Eine Flasche oder alternative Verpackung, die nicht schön ist, macht auch keine wirkliche Lust auf mehr.“
Friederike Watzl
F.W.: Hier kommt es meinen Beobachtungen zufolge immer ganz darauf an, über welchen Kanal die Weine gekauft werden und welche Zielgruppe angesprochen werden soll. Ich würde aber trotzdem auch sagen, das Auge trinkt (zumindest bei den jüngeren Generationen) immer mit. Eine Flasche oder alternative Verpackung, die nicht schön ist, macht auch keine wirkliche Lust auf mehr. Eine Flasche, die hingegen hübsch aussieht (wobei das natürlich immer im Auge des Betrachters liegt und damit zielgruppenspezifisch ist), stellt man gerne auf den Tisch, und wenn diese #instagramable ist, landen sogar Fotos davon auf Social Media. Dies sorgt wiederum für Reichweite und steigert im besten Fall die Bekanntheit nachhaltig.
Man sollte meiner Meinung nach also auf jeden Fall darauf achten, dass die Verpackung und das Design ansprechend sind. Produktmängel lassen sich damit aber langfristig nicht kaschieren. Spätestens nach dem ersten Kauf und dann dem enttäuschenden Schluck würden die Konsumenten nicht ein zweites Mal kaufen. Das sollte selbstverständlich aber auch am eigenen Anspruch des Herstellers liegen! Es ist wie bei andern Markenprodukten: Die Qualität in der Flasche sollte immer stimmen - und die Optik bzw. Verpackung kann die Wertigkeit dann nach außen transportieren.
Der bekannte Sommelier, Moderator und Entertainer Antonios Askitis sagte kürzlich: „Mich catched mehr der Inhalt einer Weinflasche als ihre Aufmachung. Es zählt, was innen ist; nicht, was außen ist. Innovationen sind Door-Opener, ja. Aber nicht, weil sie technisch oder grafisch gut gemacht sind.“ Mit welchen Methoden lässt sich der Aufwand, der in Effekte und Designs gesteckt wird, statistisch messen?
F.W.: Mit Marktforschung - bspw. mit Befragungen und Eye-Tracking.
Haben Sie den Eindruck, dass aufwändig gestaltete Verpackungen oftmals nur als „des Kaisers neue Kleider“ genutzt werden, um den gleichen Wein wie bisher teurer verkaufen zu können?
F.W.: Derartige Beispiele können durchaus auch in der Weinbranche immer wieder beobachtet werden. It’s the power of Marketing. Eine Neuauflage des Designs, der Verpackung und der Story dahinter birgt jede Menge Vermarktungspotenziale - eine limitierte Auflage des gleichen Produkts mit anlassbezogenem Sonderetikett beispielsweise. Es kann also durchaus mal eine Sonderedition oder Co-Creation „neu“ auf den Markt gebracht werden, deren Inhalt jedoch nicht neu „erfunden“ ist. Daran ist nichts verwerflich, es ist letztlich trotzdem nicht mehr das gleiche Produkt, und daher kann auch eine Preisanpassung gerechtfertigt sein. Ausnahmen gibt es immer. Das ist nicht nur in der Weinbranche so, sondern kann auch in vielen anderen Branchen beobachtet werden - nicht zuletzt in den Bereichen Beauty und Mode.
Die verwendeten Materialmischungen – beispielsweise Kombinationen aus Karton und Heißfolienveredelungen – können in manchen Fällen durchaus zu Schwierigkeiten beim Recycling führen. Endet der Wille zur Nachhaltigkeit noch zu häufig dort, wo der Kampf um die Aufmerksamkeit des Kunden beginnt?
„Oft ist es zu bequem, beim Altbewährten zu bleiben.“
Friederike Watzl
F.W.: Diese Frage lässt sich in meinen Augen nicht allgemein beantworten. Meine Vermutung ist nur: Leider ja! Oft ist es zu bequem, beim Altbewährten zu bleiben - oder es wurde noch nicht sensibilisiert und aufgeklärt. Aktive Aufklärung seitens der Etiketten- und Verpackungshersteller ist erforderlich, um zu zeigen, wo der Nachhaltigkeitsgedanke anfangen kann.
Gibt es Ihrer Einschätzung nach Materialien und Techniken, die im Verpackungsbereich noch zu wenig genutzt werden?
F.W.: Ja – von Bag in the Box über recycelte Leichtglasflaschen im Mehrweg-Pfand-System bis hin zu Mehrweg-Edelstahlfässern, Self-fill/Refill-Shops (mit eigens mitgebrachten Behältern) und Unverpackt-Läden. Letztendlich gilt das für alle Materialien und Techniken, die Ressourcen sparen (Stichwort CO2-Abdruck) und trotzdem noch dafür geeignet sind, Wein sauber und geschützt zu den Verbauchern zu bekommen.
Wie sehr waren die deutschen Winzer in den vergangenen Jahren – auch regional betrachtet – von den Auswirkungen des Klimawandels (Unwetter, Dürreperioden, übermäßige Hitze, späte Fröste …) betroffen und wie wird darauf reagiert?
D.D.: In Deutschland kommt es immer häufiger zu Wasser-Engpässen. Reben wurzeln zwar bekanntlich tief und sind relativ trockenstressresistent, aber auch das hat seine Grenzen. Werden langfristige Dürreperioden zur Normalität und sinkt das Grundwasser immer weiter ab, wird das für Weinberge zur existenziellen Bedrohung.
Im „Jahrhundertsommer“ 2003 zeigte sich erstmalig ein Problem, das zukünftig eine dominante Rolle im Weinberg spielen wird: Synthetische Dünger, die unter anderem in Form von Nährsalzen ausgebracht werden, werden von der Rebe nur aufgenommen, wenn genügend Wasser vorhanden ist. Sind die Böden trocken und gibt es keinen Niederschlag, bleibt der ausgebrachte Mineraldünger einfach im Boden und die Rebe wird nicht mit Nährstoffen versorgt. Deshalb gab es im Jahre 2003 im konventionellen Weinbau auffällig viele Weinberge, die an Mangelerscheinungen litten, insbesondere an Stickstoffmangel. In den Dürrejahren 2018 bis 2020 wiederholte sich dies in einigen Regionen, die von langanhaltender Trockenheit betroffen waren. In den nächsten Jahren wird die Unterversorgung von synthetisch gedüngten Weinbergen aufgrund langer Dürreperioden immer häufiger zum Problem werden. Die organisch gedüngten Weinberge zeigen diese Mangelerscheinungen zumeist nicht, da die Nährstoffzufuhr nicht auf Niederschlag angewiesen ist.
Damit die Mineraldünger schneller pflanzenverfügbar sind, wird im konventionellen Weinbau immer noch häufig jede zweite Rebzeile offengehalten. Bei zunehmenden Starkregenereignissen wird in offenen Rebzeilen das Thema Bodenerosion virulent. Offen gehaltene Weinbergsböden in Hanglagen werden bei Starkregen weggeschwemmt. In flachen Lagen kommt es bei Stürmen vermehrt zur so genannten Winderosion. Auch dadurch geht laut Bodenzustandsbericht der Bundesregierung jedes Jahr fruchtbarer Oberboden verloren. Die organische Düngung und der Aufbau einer nähstoffreichen Humusschicht durch Einsaaten (Leguminosen, Blütenpflanzen u.a.), Begrünung und das Einbringen von Kompost wird zukünftig die Grundlage für gesunde Weinberge. Humus und Einsaaten sorgen für eine gute Durchwurzelung und Durchlüftung des Bodens, erhöhen die Wasser- und Nähstoffspeicherfähigkeit des Bodens, fördern das Bodenleben sowie die Artenvielfalt, vermindern Bodenverdichtung und bieten Erosionsschutz.
An humusreichen Oberflächen kleben Krümel schwerer Böden weniger zusammen, wodurch die Böden weniger verdichten, die Versickerung des Regens rascher erfolgt und Erosion vermieden wird. Humus stellt eine Nährstoffquelle für die Reben dar – durch mikrobiellen Abbau der Humusbestandteile werden organisch gebundene Elemente in pflanzenverfügbare Verbindungen umgewandelt. Auch für Mikroorganismen und Bodentiere stellt Humus eine Nahrungsquelle dar. Die Proteine im Humus verhindern größere pH-Schwankungen, eine wichtige Voraussetzung für biochemische Prozesse im Boden. Der Humus beeinflusst das Porensystem sowie den Luft- und Wasserhaushalt des Bodens. Neben Wasserspeicherfähigkeit, Wasserversickerung und Wasserstabilität des Bodens wird auch die Wurzelentwicklung verbessert: die Reben wurzeln tiefer. Humus, Einsaaten und Begrünung kommen in der Klimaanpassung eine Schlüsselrolle zu, denn sie erhöhen im Kontext von Dürreperioden und Starkregenereignissen in vielerlei Hinsicht die Resilienz der Weinberge. Der Aufbau einer gesunden Humusschicht erfordert jedoch viel Zeit, in der Literatur wird von etwa 20 Jahren ausgegangen. Wenn Winzer erst mit dem Humusaufbau beginnen, wenn die mineralische Düngung nicht mehr möglich oder bezahlbar ist, ist es in den meisten Fällen zu spät.
Der Weinbau ist vom Klimawandel stark betroffen und die Veränderungen sind bereits heute sichtbar. Auch das Auftreten von neuen Krankheiten wie Esca und neuen Schädlingen wie der Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) in Deutschland wird auf den Klimawandel zurückgeführt. Die Weinbranche ist aber nicht nur vom Klimawandel betroffen, sondern trägt auf der anderen Seite selbst zur globalen Erwärmung bei, da auf jeder Prozessstufe und in fast jedem Arbeitsschritt fossile Energieträger und Materialien eingesetzt werden, durch deren Produktion und Transporte Treibhausgase entstehen. Der deutsche Weinbau benötigt dringend eine durchschlagende Klimaschutzstrategie.
„Das Einwegsystem, das im deutschen Weinbau überwiegt, ist vollkommen anachronistisch, die Energieverschwendung kompletter Irrsinn.“
Prof. Dr. Daniel Deimling
Der erste Schritt ist, dass die Weingüter Transparenz über ihre Treibhausgasemissionen schaffen. Im nächsten Schritt gilt es, diese so weit wie möglich zu vermindern, und im letzten Schritt, die verbleibenden Treibhausgasemissionen zu kompensieren. Da Humus eine der bedeutendsten Kohlenstoffsenken darstellt, liegt auch hierin ein Schlüssel zu mehr Klimaschutz im Weinbau. 57 Prozent der Treibhausgasemissionen einer Flasche Wein entfallen auf die Verpackung (Glasflasche, Verschluss, Etikett, Karton, Folie). Die Verpackung ist damit der größte Hebel, an dem es anzusetzen gilt. Im Zuge des Gasengpasses der letzten Monate und der damit verbundenen Lieferengpässe bei Glasflaschen wurde den deutschen Winzern langsam gewahr, wie viel Energie benötigt wird, um eine Glasflasche herzustellen. Das Einwegsystem, das im deutschen Weinbau überwiegt, ist vollkommen anachronistisch, die Energieverschwendung kompletter Irrsinn. Es steht völlig außer Frage, dass wir im Weinbau ein flächendeckendes Mehrwegsystem mit einheitlichen Leichtglasflaschen brauchen.
Seit 01.01.2021 ist die Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes in Kraft. Pro Tonne CO2 müssen Unternehmen zunächst 25 €, bis 2025 schrittweise 55 € und ab 2026 65 € zahlen. Bislang müssen nur Unternehmen aus den Bereichen Energiewirtschaft, energieintensive Industrie, Verkehr und Gebäude für CO2 zahlen. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass die Landwirtschaft und damit der Weinbau hinzukommen. Weingüter, die bereits heute beginnen, ihre Treibhausgasemissionen zu minimieren, werden dann wiederum einen klaren Wettbewerbsvorteil haben. Nachhaltigkeitssiegel wie FairChoice nehmen die CO2-Bilanz in den Fokus und versuchen, Bewusstsein für diese Problemlage zu schaffen. Sowohl der Input (Energie, Ressourcen) als auch der Output (Emissionen, Abfall) werden zukünftig teurer werden. Weingüter, die durch ihre Arbeitsweise wenig energieintensiven Input benötigen und die wenig Müll und Emissionen produzieren, sind nicht nur nachhaltig im ökologischen Sinne, sondern auch betriebswirtschaftlich, weil sie zukünftig geringere Kosten haben werden. Sie sind von Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen weniger betroffen und bekommen dadurch Planungssicherheit. Der Abschied vom konventionellen Weinbau und der synthetischen Düngung muss daher gar nicht ökologisch motiviert sein, sondern kann aus knallhart betriebswirtschaftlichen Gründen erfolgen.
Wie werden deutsche Weine und die zugehörigen Designs Ihrer Erfahrung nach im Ausland wahrgenommen?
F.W.: Das lässt sich nicht generell beantworten. Ich denke aber, es kommt immer ganz stark auf den Wein, das Exportland und das gewünschte Image an. Beispielsweise werden für die Exportlinien oftmals andere Designs gewählt als für Weine, die für den deutschen Markt vorgesehen sind. Das hat natürlich einen Grund. Was ich mir vorstellen kann: Im Ausland ziehen typische Designs und Symbole für Deutschland auf Etiketten. Dazu gehören u.a. Stellagen, Trachten, Black Forest, das Oktoberfest - solche Dinge schaffen unmittelbare Assoziationen mit Deutschland und deutschen Weinen.
Die German Wine Group hat es mit ihrer Exportlinie geschafft, Erkennungsmerkmale auszuarbeiten und mit in das Design ihrer Produktlinie aufzunehmen. Und dann ist natürlich noch das Logo mit drauf - und das enthält die Farben der Flagge. In meinen Augen ist das ein Best-Case-Denkansatz.
In einem Beitrag rund um das Thema Verpackungsinnovationen in der Weinbranche, den wir kürzlich veröffentlicht haben (http://www.p3-news.com/De/News/22552), machten Sie den Vorschlag, „gezielt Trend-Scouts in anderen Ländern“ einzusetzen. Welche Impulse würden Sie dadurch erhoffen bzw. was kann die deutsche (Wein-)Verpackungsbranche vielleicht nicht so gut wie andere?
F.W.: Nun, neue Ideen kommen, indem man sich Inspirationen holt. Das geht nur, wenn man die Augen offenhält und über den Tellerrand blickt. In anderen Ländern gibt es beispielsweise andere Umstände (klimatisch, infrastrukturell etc.) und Kundenansprüche, auf welche die dortigen Betriebe reagieren und dadurch neue Ansätze, Produkte und Verpackungen schaffen. Wer sagt, dass eine Idee nicht auch in Deutschland funktionieren kann? Über Trendscouts kann entdeckt werden, was in anderen Ländern funktioniert. Das lässt Rückschlüsse zu. Man denkt weiter!
Trinken Sie lieber Rot- oder Weißwein?
F.W.: Ganz klar Weißwein. Am liebsten sogar veredelt mit Perlen – ich bin Sekt-Fan (lacht).
Letzte Frage: Welchen Wein, der vielleicht noch zu wenig beachtet wird, oder welche Weingegend würden Sie unseren Lesern empfehlen?
F.W.: Armenien! Wir waren dort kürzlich auf Exkursion mit dem Studiengang. Es ist eines der ältesten Weinländer der Welt und trotzdem in Deutschland so unbekannt. Wenn man die Möglichkeit hat, Weine von dort zu probieren oder gar nach Armenien zu reisen: Ganz klar die Gelegenheit ergreifen und probieren!
Frau Watzl, Herr Professor Deimling, herzlichen Dank für das Gespräch!

M.A. Friederike Watzl, Projekt- und Studiengangskoordinatorin im Studiengang Weinmarketing und Management, Hochschule Heilbronn.

Das beispielhafte Design mit seiner anspruchsvollen Stilistik wurde von Vollherbst am Kaiserstuhl umgesetzt.
Redaktion: sbr
Abbildungen: Vollherbst [1,4]; Hochschule Heilbronn [2,3]